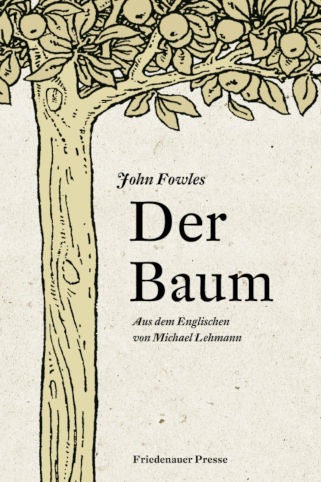
John Fowles, Der Baum (The Tree, London 1979). Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt von Michael Lehmann. Mit zwei ergänzenden Fowles-Essays im Anhang. Verlag Matthes & Seitz Berlin / Friedenauer Presse, 2022.
Der Baum (John Fowles)
Der Baum ist Fowles‘ legendärer Essay von 1979, ergänzt um zwei weitere thematisch anschließende Essays, die jeweils rund 10 Jahre davor und danach entstanden und die Kontinuität des Fowles‘schen Denkens belegen. Die drei Abhandlungen gab es bisher nie auf Deutsch und ihre Zusammenführung auch nicht im Englischen.
Das Buch ist die erste originäre deutschsprachige Edition eines Fowles’schen Werks seit 35 Jahren. Ausgehend von einer Initiative der Deutschen John-Fowles-Gesellschaft könnten bis zum 100. Jahrestag von Fowles‘ Geburtstag (2026) auch Fowles‘ wichtigste fiktionale Werke wie die Romane Der Magus und Die Geliebte des französischen Leutnants in Neuübersetzungen erscheinen.
Leseprobe (Anfang, 14 Seiten)
Die ersten Bäume, die ich schon als Kind gut kannte, waren die Apfel- und Birnbäume im Garten meines Elternhauses. Es mag ländlich und idyllisch klingen, doch das war es nicht, denn wir bewohnten eine Doppelhaushälfte in einer typischen Stadtrandsiedlung der 1920er Jahre am Unterlauf der Themse, nur etwa fünfundsechzig Kilometer von London entfernt. Der rückwärtig gelegene Garten war winzig, er umfasste keine vierhundert Quadratmeter, aber mein Vater hatte ihn an einem Ende und an einem Zaun zur Seite hin mit Spalierobstbäumen beinahe zugestellt. Selbst auf der kleinen Rasenfläche standen fünf Apfelbäume, die nur durch ständiges Auslichten und Zurückschneiden in Schach zu halten waren. Unter den eher konventionellen Hausgärten unserer Nachbarn war unser Obstgarten eine Anomalie, ja eine Spur absurd, als sei er bemüht, ein Stück Küchengarten eines großen Landhauses abzugeben. Tatsächlich hielt ihn aber niemand für eine Verrücktheit; das lag an den Früchten, die diese Bäume trugen.
Die Namen von Äpfeln und Birnen sind fast wie die Namen von Weinen – kein sicherer Anhaltspunkt für Qualität. Auf zwei Etiketten ist womöglich dieselbe Sorte angegeben, aber die beiden zugehörigen Bäume können Früchte tragen, die so unterschiedlich sind wie eine mittelprächtige und eine große Lage am selben Weinberg. Sogar die Früchte ein und desselben Baumes können von Jahr zu Jahr ganz anders schmecken. Wie beim Wein sind die wesentlichen Voraussetzungen der Boden, die Umgebung und das Klima im Jahresverlauf;
aber gleich nach diesen Zufallsfaktoren kommt die Pflege durch den Menschen. Die Bäume meines Vaters, die bereits mit dem für unsere Gegend typischen Schwemmlandboden gesegnet waren, müssen zu den am besten gehegten, ja gepäppelten in ganz England gehört haben (für sie gebetet wurde auch), und tatsächlich bescherten sie ihm regelmäßig Preise auf regionalen Ausstellungen. Unsere Äpfel waren in ihrer Art mit Sicherheit die geschmackreichsten, die ich je gekostet habe. In der heutigen Zeit der Supermärkte sind manche unserer Sorten immer seltener geworden, da sie für den Handel den offenkundigen Nachteil haben, dass sie rasch weich werden, weil sie geheimnisvoller-, aber notwendigerweise eigentlich unmittelbar »vom Baum zu essen« sind. Die Erinnerungen an sie, an ihre Namen und ihren Geschmack, begleiten mich bis heute: Charles Ross und Lady Sudeley, Peasgoods Sondergleichen und Königin der Renetten. Auch die gängigeren Sorten meines Vaters wie die Comice-Birne oder die Äpfel James Grieve und Cox Orange – die Mozarts und Beethovens der englischen Pomologie – erlangten an seinen geschickt gestutzten Bäumen eine Geschmacksfülle und -feinheit, wie ich sie seitdem nur noch selten angetroffen habe. Vielleicht lag es zum Teil daran, dass er genau wusste, wann sie gegessen werden sollten. Eine Comice-Birne mag gelagert viele Wochen brauchen, um zu reifen, aber perfekt ist sie nur an einem einzigen Tag. Fast ebenso vergänglich ist Perfektion beim James Grieve.
Unsere Bäume hatten einen weit stärkeren Einfluss auf unser Leben, als ich in jungen Jahren bemerkt habe. Ich verstand sie so, wie mein Vater sie der Welt präsentierte, als bloßes Hobby seinerseits, als nichts Außergewöhnliches, mehr als etwas Unvermeidliches wie seine ständigen Geldsorgen, sein tägliches Verschwinden nach London, sein Magengeschwür – oder auf der glücklicheren Seite sein Golfspielen am Wochenende, sein Tennis, seine Vorliebe für Kricket. Aber sie waren mehr als nur Bäume, sie hatten Namen, ihre eigenen Lebensweisen und Charaktere, die als gleichberechtigt mit denen der Familie empfunden wurden.
Zwar waren Vater und ich schon damals sehr verschieden, aber das Kind, das ich war, erkannte das nicht oder hielt es nur für eine Frage des Geschmacks, vielleicht des Alters oder wiederum der Wahl des Hobbys. Jedenfalls bestärkten mich mehrere Verwandte in meiner Verschiedenheit und ließen sie in meinen Augen als gerechtfertigt erscheinen. Einer meiner Onkel war ein begeisterter Insektenkundler, er nahm mich mit zu seinen gelegentlichen »Expeditionen« aufs Land – samt Schmetterlingsnetz, Raupensammeldose, Zucker zum Füttern – und brachte mir die heikle Kunst des »Herrichtens« der »Beute« bei. Dann gab es da noch zwei Cousins, die viel älter als ich waren. Der eine war Teepflanzer in Kenia, ein leidenschaftlicher Fliegenfischer und Großwildjäger, für mich bei seinen seltenen Heimaturlauben und Besuchen in unserm Haus unstreitig der glücklichste Mann der Welt.
Der andere war das unverzichtbare Mitglied jeder anständigen englischen Mittelschichtsfamilie: ein ausgesprochener Exzentriker, der so wenig in eine Stadtrandsiedlung mit ihren Wertvorstellungen passte wie ein Igel auf ein Sofa. Ihm gelang es, eine erstaunliche Auswahl privater Interessen miteinander zu vereinen: Spitzenrotweine, Langstreckenlauf (worin er internationalen Maßstäben genügte), Geländeerkundung und – Ameisen, sein Spezialgebiet. Ich neidete ihm seine Freiheit, auf Wandertouren zu gehen, sein unermüdliches Fotografieren exotischer Orte, sein tadelloses, umfassendes Fachwissen über die Natur, und es stellte mich vor ein Rätsel, dass mein Vater diesen faszinierenden Menschen als halb verrückt betrachtete.
Sehr bald weckten diese Verwandten in mir eine Vorliebe für Naturkunde und Landschaften; das heißt eine Sehnsucht, jenen höchst unnatürlichen Bäumen in unserm Garten und allem, wofür sie standen, zu entrinnen. Damit trat ich bereits, ohne es zu merken, die Seele meines Vaters mit Füßen. Mehr und mehr spürte ich insgeheim ein Verlangen nach allem, was unsere eigene Umgebung nicht bieten konnte: Weite, Wildheit, Berge, Wälder… Ich denke, es ging mir dabei besonders um Waldgebiete, »echte« Bäume. Abgesehen von ein oder zwei Ausnahmen – den Marschen von Essex und der arktischen Tundra – habe ich flaches und baumloses Land immer verabscheut.
▲
Dort scheint einzig die Zeit gewissermaßen emporzuragen, und sie tickt dabei ohne Erbarmen wie eine Uhr. Bäume hingegen können die Zeit zu entzerren helfen, denn sie schaffen im Grunde verschiedene Zeitmaße: hier ein dichtes, schroffes, dort ein ruhiges, fließendes – niemals ist es langweilig, mechanisch, niemals unentrinnbar einförmig. Dieses Gefühl überkommt mich auch heute noch, sobald ich in eines der unzähligen verwunschenen Wäldchen im Grenzland von Devon und Dorset eintrete, wo ich mittlerweile lebe; es ist fast, als verließe man Land, um sich in Wasser zu begeben, in ein anderes Medium, eine andere Dimension. Als ich jünger war, erlebte ich diese Empfindung sehr heftig. Wenn ich mich in die Bäume hinaufstahl, war mir immer, als stähle ich mich in den Himmel.
Ob die Beziehung zu meinem Vater jemals solche Risse bekommen hätte, wenn Adolf Hitler nicht gewesen wäre, vermag ich mir nicht auszumalen. Der Zweite Weltkrieg jedoch machte unsere Entzweiung unumgänglich. Angesichts der Gefahr mussten wir unsere Vorstadt in Essex mit einem entlegenen Dorf in Devonshire tauschen, wo sich all meine heimlichen Sehnsüchte erfüllen sollten, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt hatte. Ich war froh, seine kleine Ansammlung verkrüppelter und zu eng stehender Obstbäume vergessen zu können, denn ich hatte nun meine eigene, eine Neue Welt, mein Amerika schier endloser naturwüchsiger Bäume in Devon.
Ich werde noch erklären, was sie für mich bedeuteten und immer noch bedeuten, aber zuvor muss ich meine Vermutung zu vermitteln versuchen, was die Bäume meines Vaters für ihn bedeuteten, und warum. Je älter ich werde, desto besser erkenne ich, dass der äußerlich so tiefgreifende Unterschied in unserer Haltung zur Natur, besonders in Gestalt des Baums, seltsamerweise die gleiche Bestimmung hatte, eine Art gemeinsames Wurzelsystem, ein verflochtenes, paradoxes Muster.
Mein Vater gehörte zu der Generation, deren Leben für immer vom Ersten Weltkrieg gezeichnet war. In den meisten äußeren Dingen war er konventionell und überaus sorgsam darauf bedacht, nicht gegen die Sitten der beiden Welten zu verstoßen, in denen er lebte, unserer Vorstadt und der betriebsamen Metropole London. Vor dem Krieg hatte er eine Anwaltsausbildung absolviert; aber durch den Tod eines Bruders in Flandern, dann durch den seines typisch spät-viktorianischen Vaters, der zweimal verheiratet war und zahllose zu versorgende Kinder hinterließ, sah er sich gezwungen, in den Handel überzuwechseln, und zwar mit Tabak. Der Familienbetrieb war nichts Großartiges. Er war auf Havanna-Zigarren spezialisiert, auf handgemachte Bruyère-Pfeifen, auf seine eigene Sorte Virginia-Zigaretten (ein weiterer verloren gegangener Geschmack), und er besaß zwei oder drei Läden, darunter einen in den Piccadilly-Arkaden mit ihrer ausgezeichneten Laufkundschaft.
▲
Aus verschiedenen Gründen – bestimmt nicht, weil mein Vater sich nicht genug darum gekümmert hätte – erlebte das Unternehmen im Verlauf der dreißiger Jahre den Niedergang, und der Zweite Weltkrieg ruinierte es endgültig. Aber als ich klein war, fuhr mein Vater wie die meisten Männer in unserer Nachbarschaft jeden Tag in Anzug und mit Melone nach London: eine Zugstunde hin, eine zurück. Ich kam sehr früh zu dem Schluss, dass London gleichbedeutend war mit Erschöpfung und nervöser Unruhe und dass das Einzige, was ich niemals werden wollte, ein Pendler wäre – eine Bestimmung, die ich meinen Vater in Verdacht hatte, auch für mich vorzusehen, obgleich eher aus anderen Gründen.
Heute erkenne ich, dass der Erste Weltkrieg einen zweifach grausamen Tribut von ihm forderte, nicht nur in jenen Jahren des Grauens in den Schützengräben, sondern auch in ihren sozialen Auswirkungen. Besonders in der frühen Nachkriegszeit, als er der Besatzungsarmee in Deutschland angehörte, wurde ihm ein Vorgeschmack auf das Leben eines Offiziers und Gentlemans zuteil. Von da an war er zu dem Ethos und den Ambitionen einer Klasse oder auch zu einer Lebensart verdammt, die sein zunehmend erfolgloses Geschäft gar nicht erlaubte und die unser tatsächlicher Familienhintergrund recht grotesk erscheinen ließ. Mein Urgroßvater war Schreiber bei einem Anwalt in Somerset, und ich glaube, sein Vater wiederum war Schmied.
Mir gefällt es, solche ausgesprochen gewöhnlichen Vorfahren zu haben, doch meinem Vater gefiel es nicht, zumal er zu der ersten Generation nach dem Heraustreten Südwestenglands aus dem unvergessenen Dunkel der Historie und seinem Einlass ins wohlhabende London der Kaufleute zählte. Er war kein Snob, sondern sehnte sich einfach nach einem prachtvolleren Leben, als das Leben es erlaubte. (Er hatte nicht mal die Möglichkeit des Snobs, etwas dafür zu tun, weil er überaus vorsichtig mit Geld umging – und umgehen musste –, eine Eigenschaft, die er weder von seinem Vater geerbt hatte noch an mich weitergab.) Dies lag weit weniger daran, dass er an etwas glaubte, was wir heute sozialen Aufstieg nennen, als vielmehr daran, dass er fortwährend etwas vermisste: den vergnügten Größenwahn, das Drei-Männer-in-einem-Boothafte eines großen Hausstands der 1890er Jahre (und der anschließenden edwardianischen Zeit) sowie Stil und Schmiss eines Kasinos der Honourable Artillery Company. Nichts davon macht ihn in irgendeiner Hinsicht zu jemand Ungewöhnlichem; aber er legte außer seinem kleinen Obstbaumhain noch andere private Anomalien an den Tag.
Am erstaunlichsten war, wie er sich von der Philosophie faszinieren ließ. Sie stillte drei Viertel seines Lesehungers, hauptsächlich die großen Deutschen und die amerikanischen Pragmatisten; das restliche Viertel bestand aus Lyrik, aber auch hier las er fast ausschließlich deutsche und französische Romantiker und nur sehr selten englische.
▲
Er konnte viele Gedichte von Mörike, Droste-Hülshoff und vom frühen Goethe wohl nahezu auswendig. Auch wenn Voltaire und Daudet zu seinen Lieblingsautoren zählten, las er in erster Linie meinetwegen auf Französisch, nachdem diese Sprache mein Schwerpunkt in der Schule und in Oxford geworden war.
Praktisch nie griff er zu Romanen. Doch er hegte ein Geheimnis, das er erst, als ich selbst ein Romancier geworden war, lüftete. Mein erstes Buch, Der Sammler, war günstig aufgenommen worden, Filmrechte wurden vergeben; und eines Tages eröffnete mein Vater mir plötzlich, auch er habe vor langer Zeit einen Roman geschrieben, über seine Erlebnisse im Krieg. Er denke, der würde ebenfalls »einen guten Film abgeben«, und bat mich, ihn zu lesen. Sein Roman war hoffnungslos steif und altmodisch, und ich wusste, kein Verlag würde ihn auch nur für eine Minute in Betracht ziehen. Einige Details vom Sturmangriff aus den flämischen Schützengräben heraus waren zwar authentisch genug, und sein zentrales Thema – die Vorkriegsliebe eines Engländers und seines deutschen Freundes zu demselben Mädchen sowie das Sich-Gegenüberstehen der Konkurrenten im Niemandsland – war wie all seine ohne Ausschmückungen kurz abgehandelten Romanthemen, darunter naturgemäß Tod und Versöhnung, an sich weder gut noch schlecht.
Aber das Manuskript las sich, als stamme es von jemandem, der kaum je ein einziges Wort all der anderen englischen Romanliteratur und Dichtung gelesen hatte, die der Erste Weltkrieg hervorgebracht hat: keinen Owen, keinen Rosenberg, keinen Sassoon, keinen Graves, keinen Manning… Und das stimmte ja auch. Seine Schilderungen waren so frei von jeder geistigen Durchdringung, die mit jenen Werken vergleichbar wäre, und dies sowohl in schreibtechnischer als auch in emotionaler Hinsicht, dass sie beinahe einen Wert als Rarität besaßen, als Zeitzeugnis. Ich fragte ihn, ob ich versuchen solle, seinen Roman privat drucken zu lassen, doch er wünschte sich das Glück, das sein Sohn gehabt hatte, nämlich öffentliche Anerkennung und Erfolg, und ich kam nicht umhin, ihm die grausame Wahrheit zu eröffnen.
Als ich ihm zum ersten Mal erzählt hatte, dass etwas von mir veröffentlicht werden würde, war meiner Überzeugung nach die finanzielle Seite für ihn der größte Schock; denn das anomale Gegenstück zu seiner anomalen Verehrung der Philosophie und der Dichtung der Romantik war eine Obsession für Ertrag: Genauso wie er sich schier endlos um seine Obstbäume kümmerte, genauso behielt er unaufhörlich den Kurs seiner Wertpapiere und Geschäftsbeteiligungen in der Financial Times im Auge – ich glaube, mit der gleichen Sachkenntnis, auch wenn er nie sehr viel zu investieren hatte.
▲
Tatsächlich hatten sich beide Dinge im Laufe der Zeit irgendwie miteinander verflochten, denn Teil des Obsternte-Rituals war jeden Herbst die Berechnung, wie viel die Früchte erbracht hätten, wenn sie einem örtlichen Obst- und Gemüsehändler verkauft worden wären; in Wirklichkeit wurde der stets beträchtliche Überschuss an Verwandte und Nachbarn verteilt, aber ich bin sicher, diese hypothetische »Dividende« war ihm wichtig. Das größte Lob, das er seinen eigenen Produkten spendete, war die Mitteilung der Summe, die sie gemäß den veröffentlichten Preisen der Vorwoche erbracht hätten; als fügte es ihnen ein Gütesiegel hinzu, das ihr vorzüglicher Geschmack und Zustand niemals hätte gewähren können. Es war nicht der für Vorstadtverhältnisse etwas skandalöse Inhalt von Der Sammler, der ihn so sehr beunruhigte; vielmehr war es der Gedanke, das Buch würde vielleicht ein Fehlschlag. Als es diese Hürde genommen hatte, plagte ihn die Befürchtung, ich könne womöglich das vernünftige, wenn auch bescheidene Sicherheitsnetz des Lehrerberufs zugunsten des Vollzeitschreibens hinter mir lassen. In seinen Augen habe ich damit leichtsinnig einen Goldesel aufs Spiel gesetzt.
Alles, was ich mit seinem Roman anstellen konnte, war, eventuell ein paar Auszüge von Schlachtfeldbeschreibungen für eine Passage in meinem Roman Der Magus zu verwenden.
Doch kurz bevor mein Vater starb, saß ich eines Nachmittags an seinem Bett in einem Pflegeheim; er hatte Schmerzen, war mit Medikamenten vollgepumpt und schien zu schlafen. Da fing er plötzlich an zu reden, ein merkwürdiges Gerassel von Staccato-Sätzen, eine Pause, dann weiter und wieder eine Pause. Es hatte mit einem Freund zu tun, der bei einem Angriff umgekommen war, unmittelbar neben ihm, und er berichtete dies in Form eines Zwiegesprächs zwischen ihm und einem Dritten, der auch dabei gewesen war. Er erzählte es nicht mir, sondern es rührte von seinem nahen Koma her. Es existierte keine Zeit, es gab nur das Jetzt, wieder und auf ewig, unendlich lebendiger in diesen Fetzen abgebrochener Sätze als in allem, was er je über seine Schlachtfelderlebnisse geschrieben oder mir bei Bewusstsein erzählt hatte. Die waren vor der versammelten Familie immer tabu gewesen. Erinnerungen an Ypern und andere zerstörte Städte, Quartiere in Schlössern abseits der Frontlinie, das Leben im besetzten Köln, ja; aber denen gegenüber, die so etwas noch nicht erlebt hatten, war er nie zum Kern der Sache gekommen: diesem ewigen Rennen, Marschieren, Sich-Dahinschleppen durch Stacheldraht und Bombenkrater, dem in jedem Moment möglichen Tod entgegen.
An jenem Tag neben seinem Bett musste ich an all die Wegscheiden in unser beider Leben denken, an denen ich ihn oder zumindest das, woran er glaubte, ermordet habe; besonders dachte ich an eine seiner grundlegenden Lebensentscheidungen, die ich nie vergessen habe, obwohl ich seit Langem nicht mehr darunter leide. Sie geht zurück bis in die Zeit am Ende des Zweiten Weltkriegs.
▲
Wir hatten dieses Ende als Selbst-Evakuierte in einem Dorf in Devonshire abgewartet, eine Episode, die ich in meinem Roman Daniel Martin fiktionalisiert habe. Trotz der äußeren Schrecken und Entbehrungen dieser Zeit waren es für mich ergiebige grün-goldene Jahre. Zum ersten Mal lernte ich die Natur auf dem echten Land unter echten Landleuten kennen, und von da an war ich als Städter unwiederbringlich verloren. Seitdem verbrachte ich zwar noch lange Jahre in Städten, aber nie bereitwillig, immer im täglichen Exil. Ich habe damals sogar das antiquierte Klassensystem des Dorflebens mit seinem Landadel und seinen »Bauern« (und den unendlichen Abstufungen dazwischen) der Uniformität der Vorstadt vorgezogen, den immer selben Straßen und Häusern, denselben Ängsten, demselben Dünkel. Doch dann, nachdem der Krieg vorbei war, beschloss mein Vater, wir hätten das grüne Paradies wieder zu verlassen und in das graue Gefängnis zurückzukehren. Keiner seiner offenkundigen Gründe – das Geschäft und die Notwendigkeit, in der Nähe von London zu sein – schien mir ehrlich. Der Familienbetrieb war ja so gut wie am Ende, und er hatte keinerlei kulturelle Interessen (es sei denn, man zählte Profi-Kricket dazu), von denen er durch die Entfernung zwischen London und Devon ausgeschlossen gewesen wäre.
Heute kann ich nur vermuten, dass ihn das Erleben der gesellschaftlichen Abgrenzungen auf dem Dorf aus der Fassung gebracht hatte, jenes uralte Gespür für den Unterschied zwischen einem Status, der durch finanziellen Erfolg oder Bildung erreicht, und einem, der von den Vorfahren ererbt oder von zahllosen Generationen »herangezüchtet« worden war. Aber ich glaube, es war vor allem die Vielfalt der Wahlmöglichkeiten, wie und wo man leben wollte, die er auf dem Land in Wirklichkeit nicht mochte. Zwar entsprachen ein paar der größeren Häuser und Gärten in unserm Dorf wohl seinem Traum. Der auffallendste Gentleman des Ortes aber wohnte in einem der kleinsten Cottages! (Dass dieser Herr mich unter seine Fittiche genommen und fischen und schießen gelehrt hatte, war ein weiterer Vatermord am Scheideweg.)
Ich habe das Gefühl, dass unsere Vorstadt in der Erinnerung meines Vaters (wobei sich daran zu erinnern auch eine völlig neue Erfahrung für ihn war) wohl etwas darstellte, das der berühmten alten Kameradschaft in den Schützengräben ähnelte, dem tröstenden Gefühl, alle säßen im selben Boot: alle artig in den gleichen eingeschränkten finanziellen Verhältnissen, mit den gleichen vagen Hoffnungen und mit einem Festhalten an den gleichen stillschweigend gutgeheißenen Regeln. In Devon dagegen war alles viel zu transparent, nicht zugänglich für ungerechte Wertsysteme, die ihrerseits nicht offen für die Natur gewesen wären; (…)
▲
