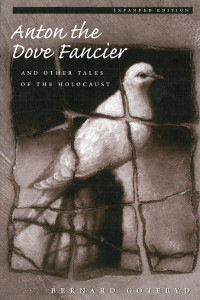
Bernard Gotfryd, Anton der Taubenzüchter und andere Geschichten vom Holocaust (Anton the Dove Fancier and other Tales of the Holocaust, The Johns Hopkins University Press, USA 1991, erweiterte Neuausgabe 2000), aus dem Englischen von Michael Lehmann.
Blog Interview
Anton der Taubenzüchter und andere Geschichten vom Holocaust (von Bernard Gotfryd)
Bernard Gotfryd, Fotograf und Autor, geboren 1924 in Radom/Polen, als Jugendlicher während des 2. Weltkriegs Kurierdienste für den polnischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung, Häftling verschiedener Konzentrationslager bis zur Befreiung im Mai 1945, Auswanderung in die USA 1947, mehr als 30 Jahre lang Fotoreporter von Newsweek, lebt im Staat Vermont/USA. Sein überaus reiches fotografisches Lebenswerk ist archiviert bei der renommierten New York Historical Society. Die Erzählungen Anton the Dove Fancier wurden sehr erfolgreich in allen Weltsprachen veröffentlicht – bislang aber nicht im deutschsprachigen Raum.
Bildband The Intimate Eye, Foto-Porträts bekannter Zeitgenossen (von den Beatles bis zum Papst), USA, 2006.
Erzählungenband Anton the Dove Fancier and Other Tales from the Holocaust, USA, 1990, im Jahr 1991 ausgezeichnet von PEN America mit einer besonderen Erwähnung; erweiterte Neuausgabe 2000.
Anton der Taubenzüchter (Auszug)
Genau gegenüber dem Mietshaus, in dem ich wohnte, stand eine lange Reihe aneinandergebauter Holzschuppen. Es war leicht genug, von dort, wo die Mülltonne stand, aufs Dach zu klettern und die ganze Länge der Schuppen entlang zu laufen, bis dahin, wo aus dem angrenzenden Obstgarten ein Birnbaum wuchs. […] Wenn das Wetter gut war, konnte ich mich am Dachrand auf dem Rücken ausstrecken und zusehen, wie Anton vom angrenzenden Hof aus seine Tauben trainierte. […] Sie schossen immer wie Pfeile hin und her, verbargen sich hinter bauschigen Wolken oder strebten der Sonne entgegen, flogen höher und höher, ständig ihren Kurs ändernd, um sich endlich in winzige, bewegte Punkte aufzulösen.
Anton schwenkte dann eine lange Stange mit einem roten Tuchfetzen daran und pfiff schrill. Die Vögel schienen auf seine Kommandos zu reagieren, oft gesellten sich sogar herrenlose Tauben zu seiner Schar und landeten oben auf dem Schlag. Wenn eine seiner Tauben verlorenging, schüttelte er die Fäuste und stieß endlose Tiraden Flüche aus. Nach der Art und Weise, wie er gegen den Himmel wütete, schien es, als ob er Gott selbst anschrie.
Anton war Hausmeister in dem Gebäude neben uns und ein stämmiger, gutgebauter Mann, wahrscheinlich in den Dreißigern. Er hatte ein breites, rotbackiges Gesicht mit hohen Wangenknochen und hellblauen, weit auseinanderliegenden Augen. Wenn er sprach, glitzerten mehrere Goldzähne. […] Zu allen Zeiten baumelte eine silberne Kette mit einem ansehnlichen Kruzifix aus seinem Hemd.
Wenn seine Tauben nicht flogen, pflegte sich Anton unter die Lindenbäume zu legen und zu schlafen. Nichts konnte ihn wecken, nicht einmal ganze Banden kämpfender, kreischender Kinder beim Versteckspiel. Wenn seine Frau ihn brauchte, schüttelte sie ihn nur an den Schultern und zog ihn auf die Beine. Sie war eine blonde Frau mit großer Brust und fast so hochgewachsen wie Anton selbst. […] »Sieh mich an, du betrunkenes Schwein,« schrie sie dann und hielt ihn fest, »ich bin nicht deine weiße Preistaube, ich bin deine Frau. Kannst du mich erkennen? Dann steh auf und komm mit.« […]
Anton war launisch, sogar mit den Tauben. Manchmal behandelte er sie, als wären sie Menschen; ein andermal drohte er ihnen, sie zu braten. Manchmal tauchte er am Taubenschlag mit einer Flasche Wodka auf, die aus seiner Gesäßtasche hervorschaute. Dann ließ er die Tauben frei, und indem er mit einer Hand die lange Stange hielt, schaffte er es, mit der anderen seinen Wodka herauszuangeln. Sein Gesicht wurde dann ganz rot, und er schrie den Tauben seinen Lieblingsspruch entgegen: »Fliegt, fliegt, meine schönen Vögel, aber kommt bloß wieder!« Sobald die Tauben landeten, legte sich Anton der Länge lang ins Gras, und mit vor Betrunkenheit lallender Stimme sang er alte patriotische polnische Lieder.
Ende des Sommers, als der Krieg ausgebrochen war und die Nazis die Stadt besetzt hatten, verlor ich Anton aus den Augen. Wenn ich morgens das Haus verließ, sah ich gelegentlich seine Tauben fliegen, gelegentlich hörte ich ihn auch, wie er sich hinter den Schuppen weiter zu schaffen machte.
Eines kalten Morgens mitten im Winter 1940/41 sah ich Anton auf meinem Weg zur Arbeit, wie er in Handschellen von zwei Gestapomännern mit schwarzen Ledermänteln abgeführt wurde. Sie stießen ihn in einen dunkelgrünen Gefangenentransporter und fuhren in hohem Tempo mit ihm fort. Bald fand ich heraus warum: Die Nazis hatten Antons Tauben requiriert, und als sie kamen, um sie abzuholen, fanden sie sie alle tot im Schlag. Anton wurde festgenommen und wegen Sabotage am Deutschen Reich verurteilt.
Ein paar Monate gingen vorüber, und niemand im Haus einschließlich seiner Frau hatte irgendwelche Nachrichten von Anton. Es gab Gerüchte, er sei Brieftaubentrainer für die deutsche Reichswehr geworden und es gehe ihm gut, er lebe irgendwo in Deutschland. Seine Frau fuhr fort, für das Haus zu sorgen […], aber ich wagte nicht, sie nach Anton zu fragen. […] Eines Tages sah ich, wie seine Frau den Taubenschlag in Stücke schlug und ihn zu Feuerholz kleinhackte. Der Fallendraht wurde in eine Ecke am Zaun geworfen; die lange Stange mit dem roten Tuch verschwand.
Spät im Jahr 1943, als die Nazis die letzten Überbleibsel unseres Gettos liquidierten, wurde ich verhaftet und in das Todeslager Maidanek gebracht. Als ich gleich nach meiner Ankunft vom Duschen kam, […] sah ich jemanden in meine Richtung kommen. Er war groß und trug zwar gestreifte Sträflingskleidung, dazu aber glänzend schwarze Lederstiefel; seinen Hals umschlang ein orangefarbener Schal. Es war unbestreitbar Anton. Ich war verblüfft. Er blieb stehen und sagte: »Du bist doch der Junge aus Radom, nicht wahr? Du hast immer auf dem Dach gesessen und mich beobachtet, wenn ich meine Tauben fliegen ließ, richtig?« Ich war sprachlos und konnte das Ja nur mit dem Kopf nicken. »Wie haben sie denn dich gekriegt? Dies ist kein Ort für dich, mein Junge«, warnte er und ging weg. […]
Am folgenden Sonntag bekam ich Besuch von Anton. Er trug ein Bündel unter seinem Arm. »Ich habe dir ein paar warme Sachen zum Anziehen mitgebracht«, sagte er, indem er mir das ganze Bündel gab.
»Vielen Dank, aber ich habe nichts, womit ich Ihnen das bezahlen kann« platzte ich heraus und streckte meine Hand aus, um die seine zu schütteln.
»Sei kein Dummkopf. Hab ich dich um Bezahlung gebeten? Ich bin in der Lage, dir zu helfen, also nimm. Vielleicht mußt du eines Tages mir helfen, wer weiß. Alles ist möglich in dieser verrückten, verkehrten Welt.« Er zog ein großes Stück Brot hervor, steckte es in meine Tasche und sagte: »Iss das Brot, lass’ es dir nicht von ihnen stehlen.« Er drehte sich um und ging rasch hinaus. Die Leute, die an der Tür standen, gingen zur Seite, um ihm den Weg frei zu machen. Angst blickte aus ihren Augen.
Ich ging zu meiner Koje zurück und öffnete das Bündel. Ich fand eine dicke gefütterte Jacke, einen Wollschal und ein kariertes Flanellhemd. In den Taschen der Jacke waren zwei Wollsocken.
In der folgenden Nacht spürte ich, als ich mich zudecken wollte, eine kleine Ausbuchtung im Futter der Jacke. Ich trennte es gerade so weit auf, daß ich zwei Finger hineinstecken konnte, und als niemand herschaute, angelte ich ein gefaltetes Stück steifes, braunes Papier heraus. Darin war eine Münze. Ich beschloss, keinem davon zu erzählen, nicht einmal meinem Kojengenossen. Schließlich war die Jacke von Anton. Mußte ich es ihm nicht sagen? Sollte er nicht wissen, was darin versteckt war? Alleine auf der Latrine gelang es mir, die eingravierte Inschrift zu lesen. Es war eine amerikanische Zehn-Dollar-Goldmünze. Ich wußte, es stand unter Todesstrafe, ausländische Währung zu verstecken; ich wickelte die Münze wieder in das braune Papier und steckte sie in meine Socke.
Ein paar Tage später tauchte Anton auf. Er brachte mir etwas zu essen und zwei Aspirin, falls ich eine Erkältung bekäme. Wir rückten an die andere Seite der Baracke, wo es weniger Leute gab. Als ich ihm von meinem Fund berichtete, sah er mich ungläubig an.
»Du bist dumm« sagte er. »Warum erzählst du mir das? Du hättest eine richtige Party mit den zehn Dollar veranstalten können. Ich wußte gar nicht, daß da im Futter eine Münze war. Wenn ich es gewußt hätte, hättest du sie nie zu sehen bekommen, das kann ich dir versichern. Mit zehn Dollar kannst du dir ein Kilo Schinken kaufen, zwei Laib Weißbrot und ein Kilo Zucker. Echten Zucker, nicht Sacharin.«
»Mir wäre es lieber, Sie nähmen die Münze wieder« antwortete ich, »es ist Ihre.« Ich fischte das Stück Papier wieder heraus und übergab es ihm unauffällig. Ich merkte, daß uns ein paar Leute beobachteten, doch Anton schenkte dem keine Beachtung. […]
Ein paar Wochen vergingen, und bald ging der Winter seinem Ende zu. Der Schnee begann zu schmelzen, die Luft wurde wärmer. Es gab Gerüchte, daß der Krieg an der russischen Front näher kam, und tatsächlich konnte man nachts donnerartiges Grollen schwerer Artillerie hören. Nicht lange, und die Nazis entschieden, das Lager zu evakuieren; jeder in unseren Baracken wurde aufgefordert, sich für den Abtransport bereitzuhalten.
Am nächsten Morgen tauchte Anton auf, als ich gerade auf den Lastwagen steigen wollte. Er brachte mir eine Feldflasche Wasser, stopfte Extrabrot in meine Taschen und gab mir eine Packung Zigaretten. »Ich brauche dich nicht länger zu lehren, was du tun mußt« sagte er, »aber wenn du am Leben bleiben willst, weißt du, rauche die Zigaretten nicht, sondern tausche sie gegen Essen. Zigaretten sind besser als Gold. Noch etwas: Wenn du zufällig meine Frau vor mir triffst, sag ihr, daß es mir gut geht.«
Ein paar Monate später und zwei Lager weiter kam ich im August 1944 im österreichischen Mauthausen an, wo ich drei Wochen lang sechsmal täglich 112 Stufen hinauf und wieder hinunter stieg, um auf meinen bloßen Schultern Felsbrocken aus einem Steinbruch zu tragen. Ein Mann, den ich in der Schlange traf, die auf die Suppe wartete, und den ich von Maidanek her wiedererkannte, fing eine Unterhaltung an. […] Er wollte wissen, ob ich daran interessiert war, etwas Suppe gegen einen Seidenschal zu tauschen. Er zog aus seiner Tasche ein kleines, zerknittertes, orangefarbenes Tuch voller Blutflecken. »Sieht aus wie der Schal von Anton, den er immer um den Hals trug« bemerkte ich. Man mußte schon ein Kapo sein, um in einem Konzentrationslager mit einem Seidenschal herumzumarschieren, und Anton war nach meiner Erfahrung der einzige, der das wagte.
»Er ist aus Seide«, sagte er. »Würdest du ihn nicht gerne haben?«
»Woher haben Sie den?« fragte ich ihn.
»Ich war beim letzten Abtransport aus Maidanek dabei«, fing er an zu erzählen, »ein paar Leute in unserm Wagen packten ein paar Kapos und zogen ihnen ihre Sachen aus. Einer davon war Anton. Als wir in Mauthausen ankamen, fand ich den Schal auf dem Boden des Wagens.«
»Haben sie Anton umgebracht?« fragte ich. Mein Gesprächspartner schien erstaunt über soviel Naivität.
»Was glaubst du denn?« antwortete er und legte den Schal in meine Hand. »Ich will keine Suppe. Du kannst ihn auch so behalten« sagte er und ging zu den Baracken zurück. […]
